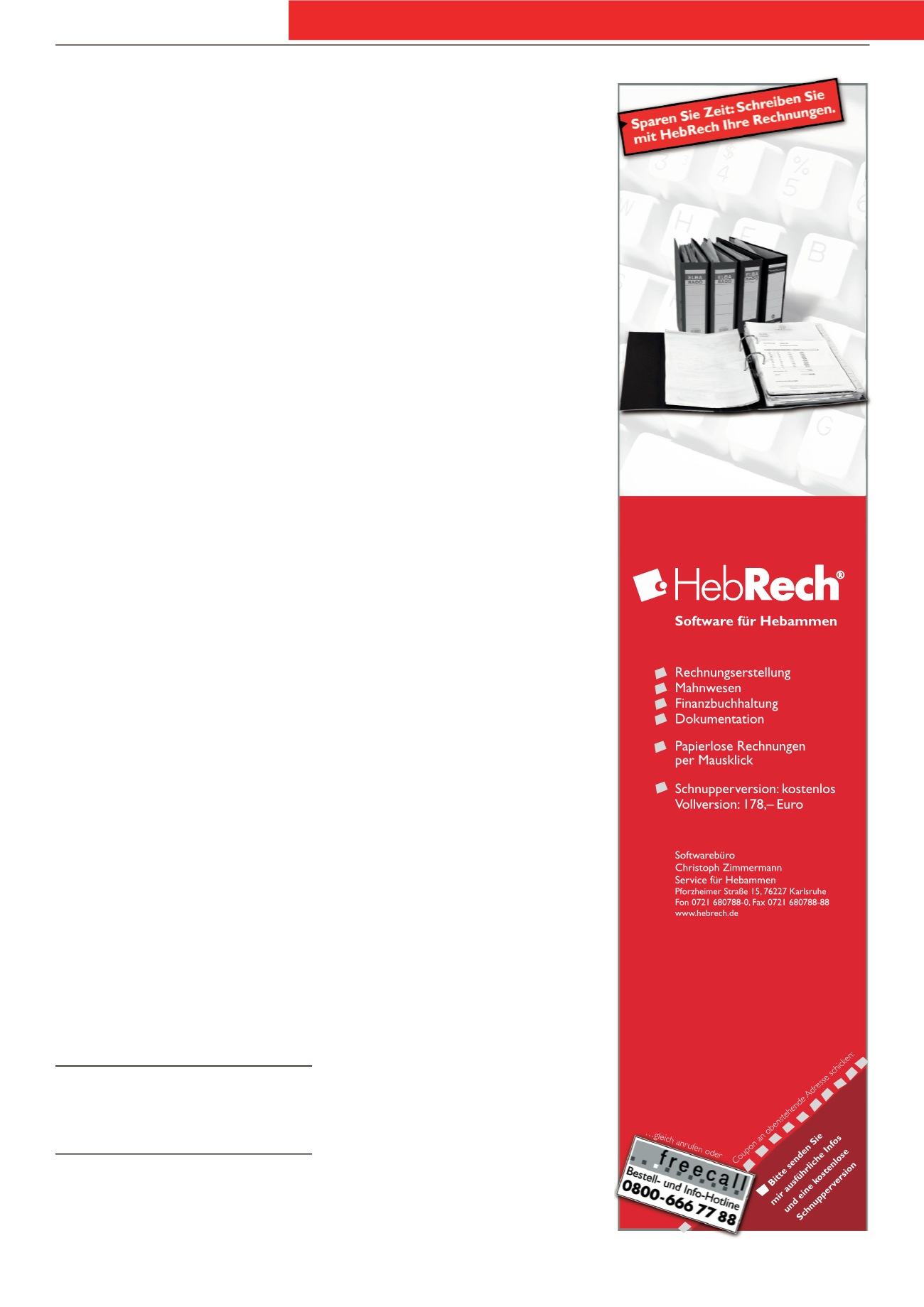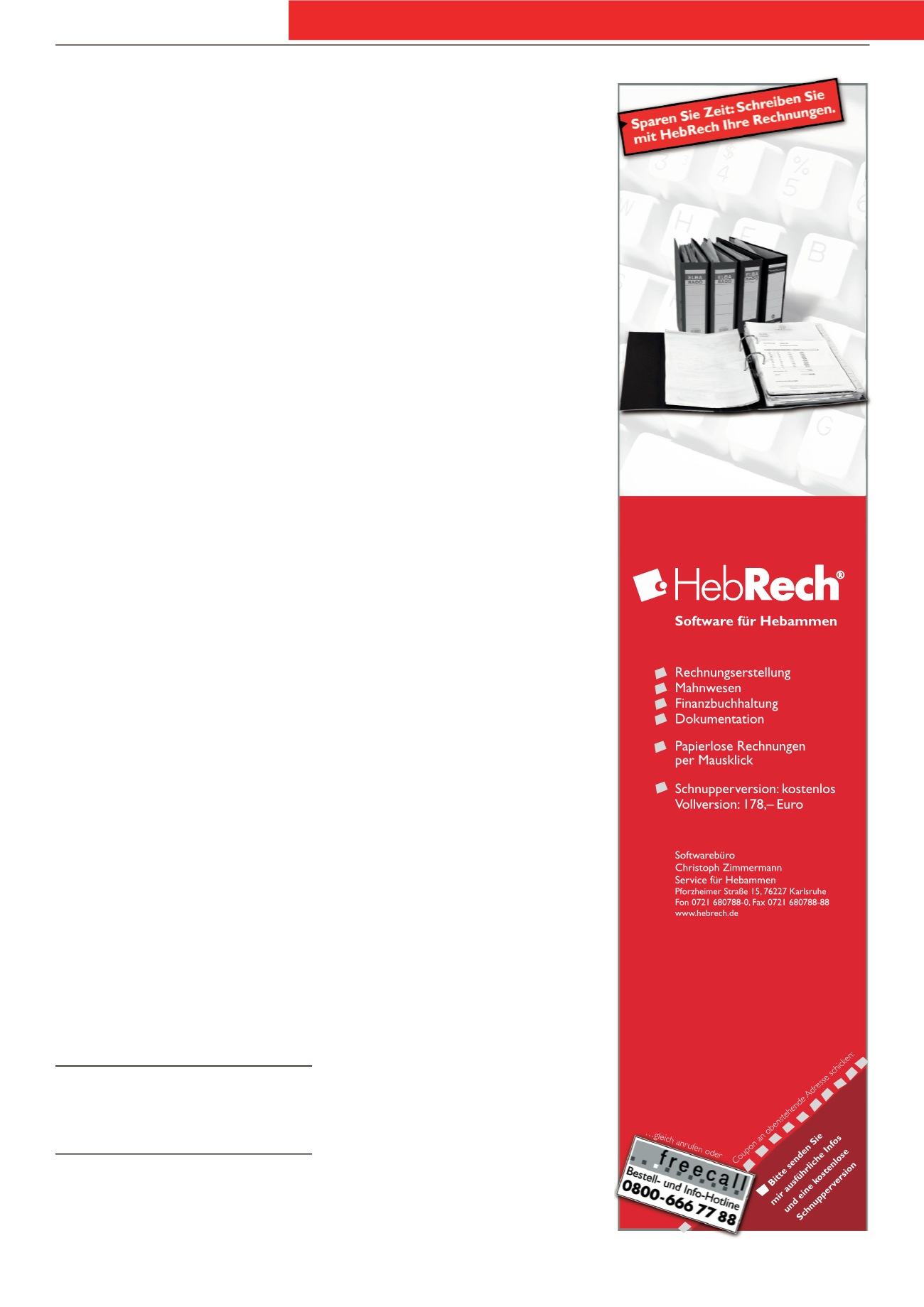
13
DEUTSCHE
HEBAMMEN
ZEITSCHRIFT 2 |2009
In manchen Regionen ist eine große Hebam-
mendichte mit daraus resultierendem zu geringem
Arbeitsvolumen ein Problem. Vielleicht findet die
Hebamme eine Marktnische, mit der sie sich eta-
blieren kann, zum Beispiel als Familienhebamme,
mit der Betreuung im Gefängnis oder Arbeit in
einer interdisziplinären Einrichtung. Auch eine
bestimmte Individualität der Berufsausübung
– Spiritualität, klassische Homöopathie oder An-
deres – kann vorteilhaft sein, so dass sich das Be-
wusstwerden und Konzentrieren auf vorhandene
Stärken lohnt. Durch gezieltes Marketing kann sich
die Hebamme damit auf dem Markt positionieren.
Wenn es der Hebamme mit ihren persönlichen
Verhältnissen möglich ist, kann auch ein Wechsel
in unterversorgte Gebiete sinnvoll sein.
Gewinn und Verlust
Die
Gewinn- und Verlustrechnung
(GuV) ist
die Basis für die Einkommenssteuer und sollte
durch oder in Abstimmung mit einer Steuerbe-
raterin erfolgen, da Fehler hier zu gravierenden
Nachteilen führen können. Allein für ein Kraft-
fahrzeug gibt es mehrere steuerlich sehr unter-
schiedlich zu behandelnde Möglichkeiten wie
Betriebsvermögen, Leasingvertrag, Fahrtenbuch,
Ein-Prozent-Regelung, bei der eine Hebamme
schnell überfordert ist.
Der Gewinn stellt dabei gleichzeitig das Brut-
toeinkommen der Hebamme dar. Von diesem
Betrag sind die Steuern und Sozialangaben wie
Krankenkassen- und Rentenversicherungsbeiträge
zu zahlen. Erst der daraus resultierende Rest stellt
das Nettoeinkommen dar, das die Hebamme
privat zur Verfügung hat. Idealerweise behält sie
sich von den Einnahmen die Beträge für Steuer
und Sozialabgaben zurück, bis diese fällig werden.
Mehr dazu unter dem Begriff der Liquidität.
Der
Break-Even-Point
ist das monetäre Errei-
chen der Gewinnschwelle eines Unternehmens.
Ab hier macht die Hebamme Gewinn. Sind die
Kosten höher als die Einnahmen, liegt ein Ver-
lust vor. Dies ist bei Existenzgründerinnen am
Anfang wahrscheinlich. Nach drei Jahren wird
im Businessplan zumeist ein Gewinn erwartet.
Bei den Ausgaben werden verschiedene
Aus-
gabenarten
unterschieden: Die Gesamtkosten
lassen sich fixen und variablen Kosten zuordnen
(siehe Kasten „Einnahmen/Ausgaben“). Den größ-
ten Anteil haben bei der Hebamme die Fixkosten.
Fixe Kosten sind all jene, die regelmäßig anfallen
ohne Rücksicht auf die Menge der Arbeitsleistung.
Diese laufen auch in Krankheits- oder Urlaubszei-
ten weiter. Variable Kosten können in der Regel
den einzelnen Kunden zugeordnet werden. Sie
verhalten sich proportional zur erbrachten Leis-
tung, so zum Beispiel der Kraftstoffverbrauch für
den Pkw, da dieser abhängig von den gefahrenen
Kilometern ist. Wird keine Leistung erbracht, liegt
der Verbrauch und damit die Kosten bei null.
Als Hilfestellung zur Unterscheidung der beiden
Kostenarten helfen folgende Fragen:
Fallen diese Kosten an, wenn ich keinen
Umsatz mache? = Fixkosten
Fallen diese Kosten nur an, wenn ich Umsatz
mache? = variable Kosten
Die Unterteilung in fixe und variable Kosten
ist deshalb so entscheidend, weil das Ziel der
Tätigkeit sein sollte, alle Fixkosten primär ab-
zudecken. Sie hilft auch, für privat zu zahlende
Angebote den Preis festzulegen. Wie hoch muss
die Gebühr sein, damit das Angebot kostende-
ckend ist? Ab wann wird Gewinn gemacht?
Beispiel 1: Fixe und variable Kosten
Eine Hebamme hat für einen Geburtsvorberei-
tungskurs drei Anmeldungen, was einem Um-
satz von 223,82 Euro (3 x 79,94
€
) entspricht.
Dafür hat sie Kosten von 240 Euro:
Umsatz
223,82 Euro
Kosten gesamt
240,00 Euro
Verlust
16,18 Euro
Dieses Geschäft scheint nicht lukrativ. Die
Absage kann aber eine Fehlentscheidung sein,
wenn man bei gleichem Angebot die Anteile
der variablen und fixen Kosten kennt:
Umsatz
223,82 Euro
Kosten variabel
20,00 Euro
(Bewirtung, Kopien u.ä.)
Kosten fix
220,00 Euro
(Raumkosten)
Verlust
16,18 Euro
Es lohnt sich, wenn dies der erste beziehungswei-
se einzige Kurs ist. Wenn er nicht angenommen
würde, läge der Verlust bei 240 Euro, da Fixkos-
ten auf jeden Fall anfallen, sie werden durch die
Auftragsausführung auf 16,18 Euro reduziert.
Beispiel 2: Überlegungen zu Investitionen
Ein CTG-Gerät ist eine kostspielige Anschaffung.
Die Ausgabe wird – als Abschreibung auf meh-
rere Jahre aufgeteilt – steuerlich berücksichtigt.
Bei den geringen Gebühren, die eine Hebamme
pro CTG bekommt, amortisiert sie sich wirt-
schaftlich gesehen nicht. Sie kann dennoch
sinnvoll sein, wenn sie für die Berufsausübung
aus Sicht der Hebamme unabdingbar ist, etwa
weil sie dadurch mehr Frauen zur Betreuung
bekommt. Denkbar ist in dieser Situation auch
das Kooperieren mit Kolleginnen oder Ärztinnen,
um ein CTG-Gerät mitzunutzen.
Wichtig: Die Liquidität
Die Möglichkeit, jederzeit alle fälligen Zahlun-
gen fristgerecht in voller Höhe bezahlen zu
Einnahmen
(= Umsatz)
– Ausgaben
(alle fixen und variablen Kosten)
= Gewinn oder Verlust
(entspricht dem steuerpflichtigen Bruttoeinkommen)
– Beiträge Rentenversicherung
– Beiträge Krankenversicherung
– Steuern
= Nettoeinkommen
(was der Hebamme privat zur
Verfügung steht)
Tabelle 1: Betriebswirtschaftliche Betrachtung der
Freiberuflichkeit
freiberuflichkeit & wirtschaftlichkeit