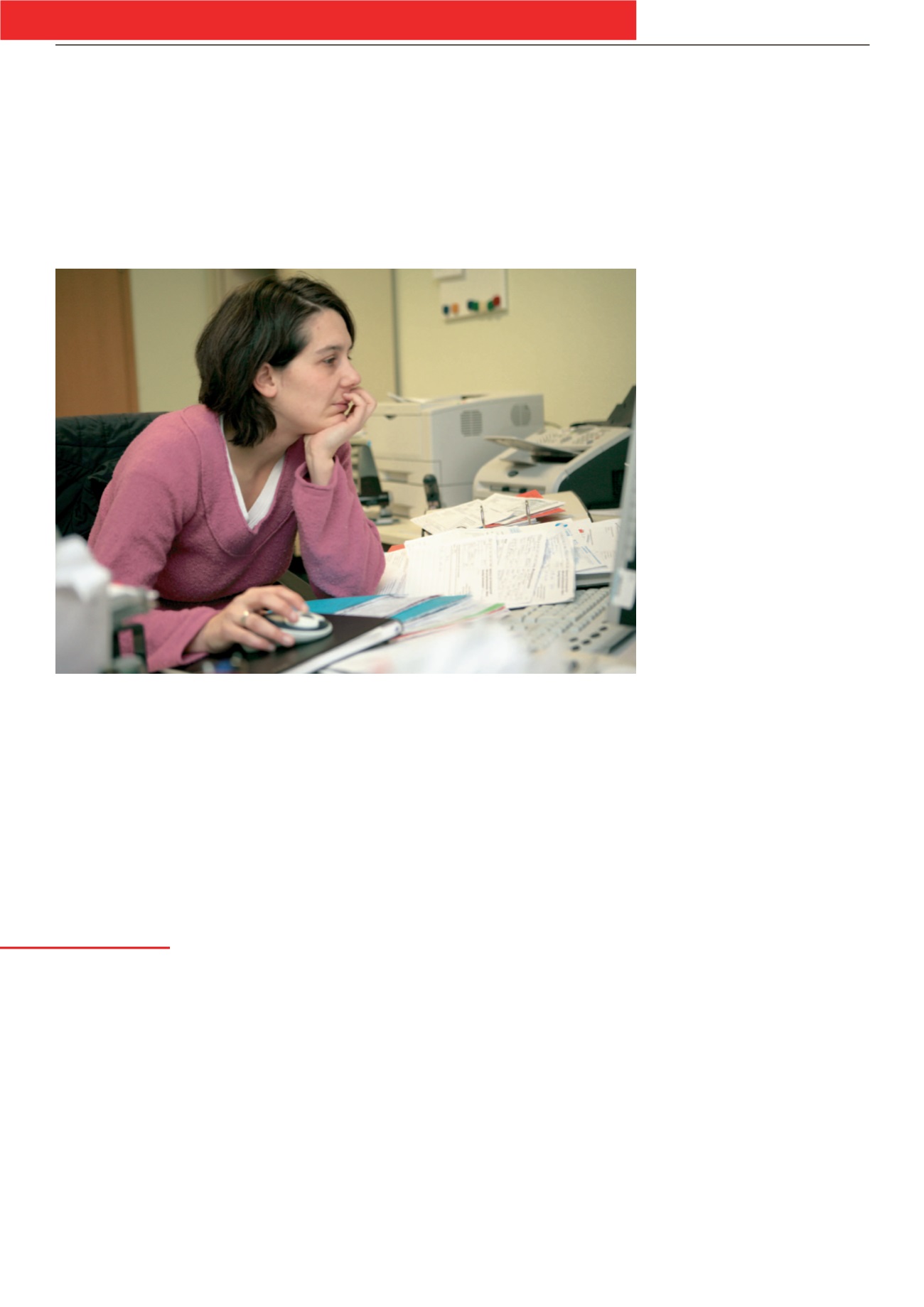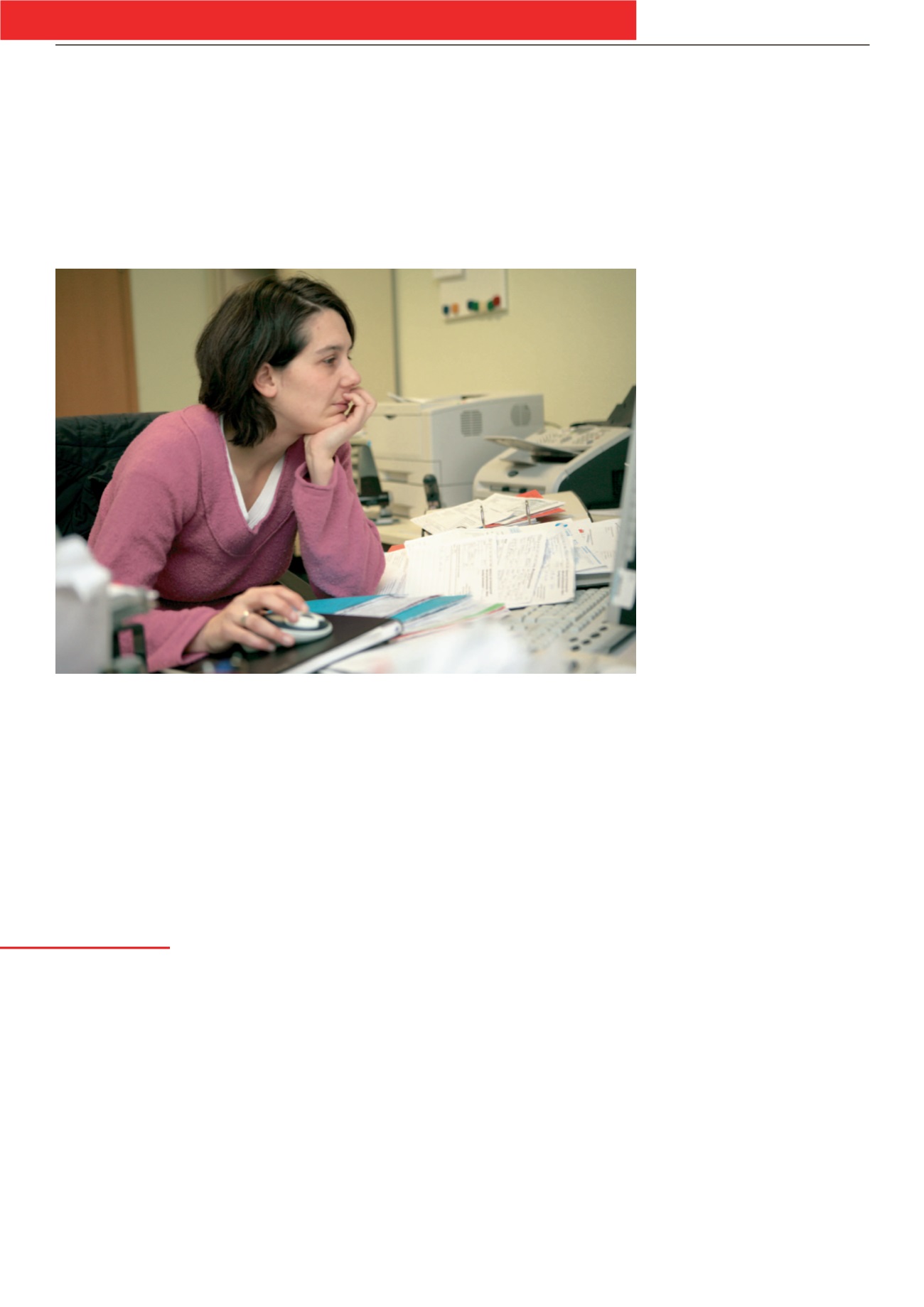
12
DEUTSCHE
HEBAMMEN
ZEITSCHRIFT 2 |2009
D
er Beruf „Hebamme“ wird selten
wegen der Verdienstmöglichkei-
ten gewählt – egal ob angestellt
oder freiberuflich. Dabei erfordert die op-
timale Versorgung der Frauen und ihrer
Familien ein hohes Maß an unterschied-
lichsten Kompetenzen. Zu diesen zählen
in der Freiberuflichkeit auch betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse. Wirtschaftliche
Aspekte sind sowohl bei der Existenz-
gründung als auch im laufenden Betrieb
wichtig und bestimmen den Erfolg der
Hebamme als Unternehmerin. Mit einem
angemessenen Arbeitsaufwand genug
Einkommen zu erwirtschaften, ist das
Ziel. Eine Hebamme kann durchaus
ihre ökonomische Situation beeinflussen
und damit auch die eigene Zufriedenheit
erhöhen oder erhalten – was wiederum
den Frauen zugute kommt.
Grundlagen
Für die Berufsausübung und Abrech-
nung sind unter anderem folgende
Grundlagen zu beachten:
n
Es gilt das Prinzip der persönlichen
Leistungserbringung: Eine Hebam-
menleistung darf dementsprechend
Hilfreich ist es, im Liqui-
ditätsplan die Zeitpunkte
der offenen Zahlungs-
eingänge und die Kosten
aufzulisten
Foto: Michael Plümer
Die Finanzen
im Blick
Tanja Riese |
Ob sich die Tätigkeit als freiberufliche Hebamme rechnet, lässt sich an ihrem Jahresgewinn
ablesen. Wichtig dabei ist es, im Blick zu haben, ob auch die Fixkosten, die unabhängig vom Angebot und
Umsatz anfallen, langfristig gedeckt sind. Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen helfen, sich klar zu
werden, ab wann sich eine Investition lohnt und ob das Einkommen für das private Leben ausreicht
nur durch eine Hebamme erbracht
werden. Vorstellbar ist das Erbringen
der Leistung durch eine bei der frei-
beruflichen Hebamme angestellte
Hebamme, nicht jedoch zumBeispiel
die Rückbildungsgymnastik durch
eine angestellte Physiotherapeutin.
n
Freiberufliche Hebammen unter-
liegen der Versicherungspflicht der
gesetzlichen Rentenversicherung.
n
Die Absicherung durch die Berufs-
genossenschaft ist obligat.
n
Für ihre Tätigkeitsbereiche sorgt die
Hebamme für eine ausreichende
Haftpflichtversicherung.
n
Zeiten von Urlaub, Krankheit, Frei-
zeit und Fortbildung erwirtschaftet
sie mit Einnahmen der Arbeitszeit.
n
Bei den Ausgaben laufen auch in
diesen Zeiten viele Kosten weiter,
egal ob Einnahmen erwirtschaftet
werden oder nicht (Fixkosten).
Wie ist unter diesen Bedingungen wirt-
schaftliches Arbeiten möglich?
Basis für die Haupteinnahmen in der
Freiberuflichkeit ist die Hebammenver-
gütungsvereinbarung (HebVV). Jeder
über die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) versicherten Frau steht
Hebammenhilfe zu. Der Zugang zur
Hebammenleistung ist damit niedrig-
schwellig. Und die Hebamme ist nicht
von der Zahlungsfähigkeit der Kun-
dinnen abhängig. Die Leistungen der
GKV stehen der Frau als Sachleistung
zu (Sachleistungsprinzip der Kranken-
kassen). Das bedeutet:
n
Es darf von der Frau keine Voraus-
zahlung gefordert werden.
n
Die Rechung wird an die Kranken-
kasse gestellt.
n
Es darf keine Zuzahlung von der
Frau gefordert werden.
Bei Privatversicherten steht dem Vorteil
von höheren Rechnungsbeträgen bei
gleicher Leistung der Nachteil der Zah-
lungsunsicherheit gegenüber. Zur Sen-
kung des Ausfallrisikos ist es dringend
empfehlenswert, Behandlungsverträge
abzuschließen und bei längeren Betreu-
ungen Zwischenrechnungen zu stellen.
Bei zahlungsunfähigen Kundinnen bringt
allerdings auch eine Klage wenig.
Sich spezialisieren
Zusätzlich können Hebammen Leistun-
gen anbieten, die nicht von der HebVV
umfasst sind und den Frauen privat in
Rechnung gestellt werden, die soge-
nannten IGe-Leistungen. Hier ist die
Preisgestaltung frei unter Berücksich-
tigung der Marktlage. Dies trifft zum
Beispiel zu auf:
n
Rufbereitschaftspauschale
n
Babymassage
n
Partnergebühr im Geburtsvorberei-
tungskurs
n
Fitnesskurse
n
Akupunktur
n
Babysitterdienst.
Der Erwerb der entsprechenden Kom-
petenzen erfordert unter Umständen
zunächst Ausgaben für Fortbildungen.
Auch die haftungsrechtliche Absicherung
ist zu überprüfen. Möchte eine Hebam-
me Zusatzleistungen anbieten, ist zuvor
eine Marktanalyse sinnvoll, um einschät-
zen zu können, ob das geplante Angebot
überhaupt auf ausreichend Nachfrage
stößt. Als Berechnungsgrundlage kann
ein unterer Stundenlohn von 45 Euro die-
nen, der damit beispielsweise über dem
der Hilfeleistung bei Beschwerden liegt.
Zur Senkung des
Ausfallrisikos
empfiehlt es sich,
Behandlungs
verträge
abzuschließen
freiberuflichkeit & wirtschaftlichkeit